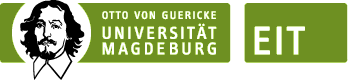Projekte
Aktuelle Projekte
Network for Evaluation of Propagation and Interference Training - MSCA Doctoral Networks
Laufzeit: 01.09.2023 bis 29.02.2028
The widespread use of modern communication systems, the higher penetration of automated systems in automotive engineering, surgery, high-tech machines etc., the higher complexity present in those interconnected systems and the higher dependence of modern society on technology, creates an urgent need to recruit and train researchers in electromagnetic compatibility. This interconnected systems-ofsystems are creating a complex electromagnetic environment in which interoperability of the electrical and electronic equipment has to be achieved. A highly trained cadre of engineers is required to lead in this area and the aim of this initiative is to train such people, connecting them to the industry for implementation of the new acquired and developed knowledge and experience. The NEPIT consortium has been brought together not only to train qualified researchers but also to provide the fundamental research that underpins future technological developments. The multidisciplinary multinational doctoral training program will provide the trainee researchers with a complete broad experience and at the same time allows them to develop and eventually lead their focused area of research. The program will focus on the development of novel methods to model, simulate, design, evaluate and test complex systems for electromagnetic compatibility.
NEPIT will also develop corrective economic measures for safe, reliable, efficient and greener complex systems. Specific innovations expected to be achieved through NEPIT are methodologies to optimize the design, to reduce risks, and to improve the testing of complex high-tech systems. Dissemination methods to realize optimal impact will include scientific publications, presentations and workshops,
summer schools, training of engineers within industry as well as communication through newsletters, interviews, school visits, websites and social media.
Effiziente Drohnenabwehr und deren experimenteller Nachweis – DrohneEx
Laufzeit: 01.01.2025 bis 31.12.2027
Entwicklung von Verfahren zur Identifizierung von Schwachstellen unbemannter Luftfahrzeugsysteme (UAS, unmanned aircraft system, Drohnen) mit dem Ziel, diese durch angepasste elektromagnetische Effekte funktionsunfähig zu machen. Die sich ergebenden wissenschaftlichen Ziele sind:
- Messaufbau zur Bestimmung eines auswertbaren rückgestrahlten Signals in verrauchter Umgebung
- schnelle Verfahren zur Bestimmung der Eigenresonanzen der Drohnen
- Aufbau einer Datenbank für eine Klassifizierung von Drohnen entsprechend erzielter Messergebnisse und Erfassung der elektromagnetischen (EM) Schwachstellen von Drohen
- Entwicklung von Verfahren und Apparate zur Erzeugung von angepassten hochenergetischen EM-Störungen
Sicherstellung der Elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) von Kraftfahrzeugen mit Fahrerassistenzsystemen
Laufzeit: 01.07.2024 bis 31.12.2027
Entwicklung von Verfahren zur Sicherstellung der Elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) von Fahrzeugen mit Fahrerassistenzsystemen (ADAS, Advanced Driver Assistance Systems) mit den wissenschaftlichen Teilzielen:
- Entwicklung von Prüfstrategien für den EMV-Test von Fahrzeugen mit ADAS-Systemen
- Bereitstellung eines EMV tauglichen Radarzielgenerator für Messungen in EMV-Absorberhallen
- Nachweis der Realisierbarkeit eines LIDAR (Light Detection and Ranging) Zielgenerators für EMV-Fahrzeugmessungen und Aufbau eines Musters
- Schaffung der Grundlagen für einen umfassenden EMV-Test von Fahrzeugen mit aktivierten ADAS Systemen als Fahrzeug in the Loop (vehicle in the loop, ViL) Test
Universal Integrated Console for Ultra-High-Field Magnetic Resonance Imaging (UIC4UHFMRI)
Laufzeit: 01.01.2024 bis 31.12.2027
Die Ultrahochfeld-Magnetresonanztomographie ist eine fortschrittliche medizinische Bildgebungstechnologie und spielt eine wichtige Rolle in der Erforschung der Gehirnfunktion und Neurobiologie. Sie ermöglicht Wissenschaftlern, detaillierte Bilder des Gehirns zu erfassen und funktionelle Aktivitäten in Echtzeit zu verfolgen. Dies kann zu einem besseren Verständnis von Gehirnerkrankungen, kognitiven Prozessen und neurologischen Störungen beigetragen. Das technische Ziel dieses Projektes ist die Realisierung einer universellen integrierten Konsole für Hochfeld-MRT-Systeme. Die in diesem Projekt entwickelte MRT-Konsole übertrifft alle bisher kommerziell oder als Eigenbau verfügbaren Systeme und ermöglicht es der OVGU und damit dem Land Sachsen-Anhalt, die Leuchtturmaktivitäten im Bereich MRT und Neurowissenschaften in den kommenden Jahren auszubauen und zu sichern. Ferner bietet das Projekt eine exzellente Möglichkeit der Einbindung in die
Hightech-Strategie des Landes Sachsen-Anhalt mit der Ansiedlung von Konzernen der Halbleitertechnologie und Mikroelektronik. Mit UIC4UHFMRI wird die Toolchain vom Design bis zur Systemintegration moderner Halbleiterbauelemente an der OVGU etabliert.
AFiMan / Entwicklung eines invasiven Verfahrens zur Identifikation der Netzimpedanz
Laufzeit: 01.03.2023 bis 31.08.2025
Im Rahmen des Projektes soll die horizontale Integration mehrerer autark arbeitender aktiver Filter auf Basis einer echtzeitfähigen Feldbus-Vernetzung sowie deren vertikale Integration zu einem übergelagerten Netzmanagementsystem realisiert werden.
Die aktiven Filter (APF-ActivePowerFilter) sollen mit einem innovativem Netzimpedanz-Messverfahren (invasives Verfahren) arbeiten. Die Echtzeitdaten der verteilten aktiven Filter werden in einem APF-Host-PC, welcher auch der Kommunikations-Master für das echtzeitfähige Filternetzwerk ist, gespeichert. Durch eine im APF-Host-PC implementierte Gateway-Funktionalität erfolgt die vertikale Integration in das Versorgungsnetz und die Anbindung an das Netzmanagementsystem.
Mit diesem geplanten aktiven Netzmanagement-System soll eine Komponente zur ganzheitlichen Sicherung der Netzqualität von Industrienetzen geschaffen werden.
Abgeschlossene Projekte
Störfestigkeitsuntersuchungen von zivilen Drohnen gegen elektromagnetische Strahlung
Laufzeit: 01.01.2020 bis 31.12.2024
Unbemannte Luftfahrzeuge (Drohnen) waren lange Zeit dem Militär vorbehalten. Der Preisverfall und die steigenden technischen Möglichkeiten von Elektronik und Sensorik haben zu einer Vielzahl an zivil verfügbaren elektromotorisch betriebener Drohnen geführt, deren Einsatzgebiete sich \ua von Foto- und Videoaufnahmen über Such- und Rettungsaktionen bis zur Frachtzustellungen erstrecken. Mit diesem Wachstum nehmen Zwischenfälle an kritischen Infrastrukturen wie z.B. Flughäfen stark zu. %hat die Anzahl von Zwischenfällen
Als Reaktion darauf haben mehrere Länder neue Regulierungen für den zivilen Luftraum erlassen. Das Risiko krimineller bzw. terroristischer Nutzung sinkt damit allerdings nicht. Für die zivile Abwehr dieser Drohnen gibt es aktuell keine zuverlässigen Konzepte. Derzeitige Schutzkonzepte sehen u.a. Abfangdrohnen mit Netzen, Projektile oder abgerichtete Greifvögel vor. Auf dem Markt für Abwehrsysteme existieren auch Systeme, die auf elektromagnetischer Strahlung basieren. Durch breitbandige Störsignale wird dabei die Funkverbindung zwischen Drohne und Basisstation gestört, welche die Drohne in den meisten Fällen zum Landen zwingt. Umfangreiche Untersuchungen zu den Wirkmechanismen elektromagnetischer Strahlung auf zivile Drohnen gibt es bisher nicht.
Aus diesem Grund ist es Ziel der Untersuchung, die Möglichkeiten der effizienten Störung bzw. Zerstörung von Drohnen durch den Einsatz von elektromagnetischen Quellen nachzuweisen. Im ersten Schritt sollen mithilfe von kommerziell erhältlichen Drohnen messtechnische Untersuchungen zur Störfestigkeit durchgeführt werden, um kritische Frequenzen und Feldstärken zu ermitteln, bei denen die Funktionsfähigkeit der Drohnen eingeschränkt wird. Anhand dieser Daten sollen Störmechanismen identifiziert und elektromagnetische Einkopplungspfade näher untersucht werden.
Schnelle Dipolapproximation zur Beschreibung der Streuung und Abstrahlung beliebiger Leiter- und Schlitzgeometrien in Resonatoren und im Freiraum
Laufzeit: 01.01.2022 bis 31.12.2023
Es soll ein neues Verfahren zur Beschreibung der Streuung elektromagnetischer Wellen an geraden,
dünnen Leitern und schlitzförmigen Aperturen verallgemeinert werden, um die Streuprozesse auch an beliebig geformten eindimensionalen Strukturen analytisch zu beschreiben. Dazu wird das Gesamtproblemmit Hilfe der Methode der analytischen Regularisierung in einen Anteil der Nah- und Fernwechselwirkungder Quellen und Felder zerlegt, um anschließend unter Ausnutzung der charakteristischen Eigenschaftender Anteile jeweils analytische Lösungen zu finden.
Emissionsmessungen im Frequenzbereich von 6 GHz bis 40 GHz
Laufzeit: 01.01.2022 bis 31.03.2023
Ein klassischer Schwerpunkt der elektromagnetischen Verträglichkeit ist der Schutz von Funkkommunikationsdiensten vor unerwünschter Störaussendung. Um den Schutz zu gewährleisten, müssen elektrische Geräte standardisierte Grenzwerte einhalten.
Mit der Einführung von 5G-Diensten haben sich mehrere neue Funkdienste weit oberhalb 6 GHz etabliert. Umauch diesen Frequenzbereich abzudecken, wurden die bisherigen Messverfahren für Frequenzenbis 6 GHz auf einen Frequenzbereich bis 40 GHz übernommen. Da bei hohen Frequenzen und entsprechenden kleinen Wellenlängen die elektrische Größe des Prüflings wächst, steigt die Komplexität des Abstrahldiagramms. Die Erfassung der maximalen Emission mit den etablierten Verfahren, erweist sich dabei aufgrund des thermischen Rauschens der Geräte, der Dämpfung der Signale durch Kabel und die hohe Direktivität der Prüflinge als schwierig. Ein höherer Antennengewinn hilft zunächst den Dynamikbereich zu verbessern, aber verringert gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit die höchste Emission zu erfassen und steigert dadurch den Messaufwand erheblich. Als alternative Messumgebung kann in einer Modenverwirbelungskammer der Messaufwand verringert werden, da aufgrund der Funktionsweise der Modenverwirbelungskammer die gesamt abgestrahlte Leistung ohne Drehung des Prüflings oder Neigung der Antenne aufgenommen werden kann. Das Ziel dieser Studie ist die Untersuchung verschiedener Messmethoden in Bezug auf Reproduzierbarkeit und praktischem Aufwand.
Erweiterung der SEM (Singularity Expansion Method) für dünne Drahtstrukturen 2
Laufzeit: 01.07.2020 bis 31.12.2022
Das Hauptziel des Forschungsprojektes ist die analytischeUntersuchung der Ströme auf verdrillten Leitungen imFrequenzbereich, um das Verständnis des elektromagnetischenVerhaltens dieser Leitungen zu verbessern. Dazu werden einasymptotischer Ansatz und eine iterative Methode, welche für gleichförmige Leitungen entwickelt wurden, für verdrillte Leitungenerweitert. Auf diese Weise werden Hochfrequenzeffekte bei deranalytischen Lösung mit beachtet. Die Ergebnisse werden verwendet,um unter anderem die komplexen Resonanzfrequenzen verdrillter Leitungen mit denen äquivalenter gleichförmiger Leitungen zu
Sicherung der Versorgungsqualität durch optimierten Einsatz verteilter, aktiver Oberschwingungsfilter in Verteilnetzen
Laufzeit: 01.01.2019 bis 31.12.2022
Das Forschungsvorhaben soll einen Betrag zur Sicherung der Versorgungsqualität unter Berücksichtigung der Integration erneuerbarer Energien in Industriekomplexen und Zweckbauten leisten. Es wird ein intelligentes System verteilter, aktiver Filter konzipiert und als Demonstrator realisiert, dass die Oberschwingungsbelastung in Niederspannungsnetzen reduziert.
Das System wird aus mehreren kompakten Einheiten bestehen, die an variablen Orten innerhalb eines Niederspannungsabgangs installiert werden können. Die einzelnen Filtereinheiten teilen sich die Aufgabe der Oberschwingungsverringerung. Es wird angestrebt, dass dies ohne Kommunikation der Filter untereinander möglich ist. Der jeweilige Wirkanteil wird dabei im Verhältnis zur Nennleistung der einzelnen Filter stehen. Im Fokus steht auch die Vermeidung instabiler Systemzustände, wie sie beispielsweise durch Resonanzerscheinungen hervorgerufen werden können. Innovativ wird u.a. der Einsatz Siliciumcarbidbasierter Halbleiter sein. Neben der reinen Oberschwingungskompensation werden weitere Kriterien zur Verbesserung der Spannungsqualität wie Reduktion von Unsymmetrien und Flicker sowie Leistungsfaktorkorrektur berücksichtigt.
Im Vergleich zu einem einzelnen Filter mit großer Nennleistung wird mit dem System die Verringerung des Oberschwingungslevels in öffentlichen Niederspannungs- und Industrienetzen mit verbesserter Kosteneffizienz angestrebt. Die modulare Größe der einzelnen Einheiten wird im Vergleich zu bisherigen Filterlösungen in Schrankgröße eine Verbesserung der Energieeffizienz bei flexiblem Einsatz bewirken.
Das Gesamtsystem zeichnet sich durch einfache Bedienbarkeit bei hoher Funktionalität aus.
Konstruktion eines Messadapters zur Bestimmung der dielektrischen Eigenschaften von Tonproben
Laufzeit: 01.01.2022 bis 30.11.2022
Im Projekt soll ein Messadapter entwickelt und konstruiert werden, mit dem die dielektrischen Eigenschaften von Tonproben, insbesondere deren komplexwertige Permittivität und der Verlustwinkel, im Frequenzbereich bis zu einigen Gigahertz genauer untersucht werden können. Dazu soll eine koaxiale Anordnung entworfen werden, die eine Zweitor-Streuparameter-Messung mit einem Vektornetzwerkanalysator ermöglicht. Die koaxiale Anordnung soll dabei im leeren Zustand einen Wellenwiderstand von etwa 50 Ohm aufweisen, der in der Hochfrequenzmesstechnik üblich ist. Aus der Änderung der gemessenen Reflexions- und Transmissionskoeffizienten der mit Tonproben gefüllten Anordnung soll dann auf die Eigenschaften der Proben geschlossen werden.
Messung und Simulation der Störemissionen von kontaktlosen Ladesystemen bei autonomer Positionierung
Laufzeit: 01.01.2022 bis 31.10.2022
Resonante induktive Ladesystem bzw. Wireless-Power-Transfer-Systeme (WPT-Systeme) werden zum Laden von mobilen System wie autonom agierenden Robotern eingesetzt werden. Ein entscheidender Faktor für die erwartenden Störemissionen in Bezug auf die elektromagnetische Verträglichkeit derartiger WPT-Systeme ist die genaue Positionierung des Roboters über der Ladespule. Im Rahmen des Forschungsprojektes wurden der Einfluss der Positioniergenauigkeit autonom fahrender Roboter mit WPT-Ladetechnologien auf die elektromagnetischen Störemissionen untersucht und hinsichtlich der Anforderungen der zutreffenden EMV-Normen bewertet werden.
Messung und Analyse der Abschirmung für einen RFID-Tunnel mit Hilfe des Konzeptes von verschachtelten Modenverwirbelungskammern
Laufzeit: 01.01.2022 bis 30.09.2022
RFID-Tunnel werden für die drahtlose Verfolgung von Paketen und Gütern entlang von Transportwegen und in Lagerhäusern und Logistikzentren eingesetzt. Es handelt sich um ein sehr kostengünstiges Verfahren, bei dem die Tags während des Auslesevorgangs mit einem elektromagnetischen Feld versorgt werden, so dass die Tags keine eigene Batterie benötigen. Für eine zuverlässigere RFID-Auslesung wird der Tunnel elektromagnetisch abgeschirmt. Im Forschungsprojekt wurden verschiedene Methoden zur Messung der Schirmdämpfung eines bestehenden RFID-Tunnels getestet. Zu diesem Zweck wurde das Konzept der verschachtelten elektromagnetischen Modenverwirbelungskammern verwendet, da es ein statistisch homogenes und isotropes Feld, einen hohen Dynamikbereich und somit ein zuverlässiges und effizientes Messverfahren bietet.
Analyse der Einkopplung statistischer elektromagnetischer Felder in Leitungsstrukturen im Zeitrereich
Laufzeit: 01.05.2019 bis 31.07.2022
Innerhalb dieses Projektes ist geplant, erstmals die Einkopplung statistischer Felder in Leitungsstrukturen im Zeitbereich zu untersuchen. Es werden sowohl zwei- als auch dreidimensionale Leitungsstrukturen theoretisch und experimentell betrachtet. Auch auf nichtlineare Leitungsabschlüsse und die damit verbundenen Effekte wie einer zeitlichen Änderung der Reflexionsparameter, einer Demodulation hochfrequenter Träger und einer Intermodulation verschiedener Frequenzanteile wird eingegangen. Der experimentelle Nachweis jeder Theorie erfolgt durch Messungen sowohl in einer GTEM-Zelle für eine ebene Welle als auch in einer Modenverwirbelungskammer für ein stochastisches Feld.
Analytische Näherung des Reflexionskoeffizienten mit Hilfe der Induced "EMF" Methode
Laufzeit: 01.01.2020 bis 31.12.2021
Der Reflexionskoeffizient von Leitungsabschlüssen spielt in vielen praktischen Anwendungen eine große Rolle. In der Regel versucht man Reflexionen bei der Signalübertragung zu vermeiden, um Störungen möglichst gering zu halten.
Die klassische Leitungstheorie liefert einen bekannten Ausdruck für den Reflexionskoeffizienten in Abhängigkeit der Abschlussimpedanz und der charakteristischen Impedanz der Leitung. Die klassische Leitungstheorie betrachtet jedoch nur transversal elektromagnetische (TEM) Moden. Diese Einschränkung ist für kleine Frequenzen bzw. große Wellenlängen verglichen mit den transversalen Abmessungen der Leitung legitim und liefert genaue Ergebnisse. Die Datenraten und Signalfrequenzen werden jedoch in vielen Anwendungsgebieten größer und andere Lösungsverfahren werden benötigt.
Einfach zu bedienende numerische Löser liefern für beliebige Leitungsgeometrien Zahlenwerte, die interpretiert werden können. Man erhält aber selten einen tieferen Einblick in die physikalischen Vorgänge, die im Hintergrund ablaufen. Daher wurde in der Vergangenheit eine analytische, iterative Methode entwickelt, die die klassische Leitungstheorie für höhere Frequenzen erweitert. Die Methode liefert relativ genaue Ergebnisse und enthält Informationen über die höheren Moden (neben dem TEM"=Mode). Die Leitungsgeometrie am Port ist ebenfalls in der Lösung beinhaltet.
Aus theoretischer Sicht ist die Einordnung der neuen iterativen Methode interessant. Die Frage, die sich dabei stellt ist: Ist die iterative Methode einzigartig oder können die gleichen Ergebnisse auch mit anderen bekannten Methoden gefunden werden? In diesem Projekt wurde gezeigt, dass die relativ bekannte Induced "EMF" Methode das gleiche analytische Ergebnis für den Reflexionskoeffizienten liefert. Als Zwischenergebnis wurde der Reflexionskoeffizient mit der Eingangsimpedanz allgemein verknüpft.
Die Regge-Methode für die halbkreisförmige Schleife über der Erde
Laufzeit: 01.08.2020 bis 31.12.2021
Eines der Hauptprobleme im Bereich der elektromagnetischen Verträglichkeit ist die Analyse der Kopplung elektromagnetischer Felder mit Verdrahtungsstrukturen, die eine Reihe von Anwendungen haben. Zur Lösung dieses Problems werden in der Regel direkte numerische Methoden verwendet, z.B. die Methode der Momente. Diese Methoden erlauben jedoch keine tiefgreifende Erforschung des physikalischen Wesens des betrachteten Problems. Dies kann nur durch den Einsatz analytischer oder semi-analytischer Methoden erreicht werden. Wichtig sind die exakten analytischen Lösungen, die für Strukturen mit hoher Symmetrie möglich sind: ein unendlicher gerader Draht, ein kreisförmiger Draht, ein Spiraldraht und deren Kombinationen, die die Symmetrie beibehalten, z. B. ein unendlicher gerader Draht über einer PEC-Oberfläche. Hier betrachten wir eine kreisförmige Halbschleife, die senkrecht zur PEC-Masse verläuft. Diese Struktur ist die einzige endliche Verdrahtungsstruktur, für die es eine exakte Lösung der Integralgleichungen für gemischtes Potential gibt. Diese Lösung kann durch Fourier-Reihen für jede Art von Erregung erhalten werden, einschließlich verteilter Erregungen (z. B. durch eine externe ebene Welle) oder geklumpter Erregungen (z. B. durch eine Spannungsquelle). Die Lösung für die pauschale Erregung ist besonders wichtig, weil sie eine Green'sche Funktion für den Strom ist und die Lösung für einen belasteten Draht liefert.
Um diese Lösung mit angemessener Genauigkeit zu erhalten, muss man 100 bis 400 Terme in der Fourier-Reihe verwenden. In unserer früheren Arbeit haben wir gezeigt, wie man diese Fourier-Lösung vereinfachen kann, und haben mit Hilfe der phänomenologischen physikalischen Methode den Hauptterm des Stroms, der durch eine geklumpte Quelle angeregt wird, näherungsweise ermittelt. Dieser Strom ist analog zum TEM-Modus, der durch eine pauschale Quelle in einem unendlichen geraden Draht über einer PEC-Masse angeregt wird. In dieser Arbeit verwenden wir die Watson-Regge-Transformation und stellen die Fourier-Summe als ein Integral in der komplexen Ebene des Parameters m dar, der in der klassischen Fourier-Lösung eine ganze Zahl ist. Das Integral wird durch die Nullstellen der modalen Impedanz pro Längeneinheit in der komplexen Ebene des Parameters m definiert, die analog zur Streutheorie in der Quantenmechanik die so genannten Regge-Pole definieren. Die Positionen der Pole in der komplexen Ebene hängen von der Frequenz ab und bilden so genannte Regge-Trajektorien. Die Summe über die Regge-Pole ist eine exakte Lösung des Problems und entspricht der Summe der Fourier-Reihen. Der Term, der dem Pol mit dem kleinsten Imaginärteil entspricht, stimmt mit der phänomenologischen Lösung überein. Außerdem kann man nach einiger Manipulation dieses Terms die SEM-Pole der ersten Schicht für die Verdrahtungsstruktur erhalten.
Dieser Text wurde mit DeepL übersetzt
Field Homogeneity and Isotropy Analysis of a Reverberation Chamber Equipped with a Pair of Hemispherical Diffractors
Laufzeit: 01.01.2020 bis 31.12.2021
In order to analyze the possible improvement of field homogeneity and isotropy by two additional copper hemispheres mounted on the wall and floor of a reverberation chamber (see Fig.), the electric field strength has been measured at eight positions in the working volume of the chamber. The measurement has been carried out over wide frequency range using fast field sensors. The experimental results are analyzed in terms of the standard validation procedure for an empty reverberation chamber according to Annex B of the IEC 61000-4-21 as well as to the field anisotropy coefficients defined in Annex J of this standard. The results show that the copper hemispheres hardly improve the field uniformity and slightly lower the quality factor of the chamber.
Kompetenzzentrum eMobility - Forschungsbereich Autonomes Fahren: Teilprojekt " Prüfumgebung für automatisierte und autonome Elektrofahrzeuge "
Laufzeit: 01.01.2019 bis 31.12.2021
Das Vorhaben Kompetenzzentrum eMobility greift die strukturbedingten Herausforderungen auf und entwickelt im Rahmen eines neu zu gründenden Kompetenzzentrums Lösungen in wichtigen Teilbereichen, welche die Kooperation zwischen KMU und universitärer Forschung und Lehre deutlich stärken. Das Wissen kann direkt in die betroffene Zulieferindustrie überführt werden und dort dazu beitragen, den Strukturwandel erfolgreich zu managen und neue wirtschaftliche Chancen zu nutzen. Neben der primären Zielsetzung des Aufbaus und Transfers von Kern-Know-How steht vor allem die langfristige Verankerung gewonnener Erkenntnisse in beschäftigungswirksamen wirtschaftlichen Strukturen im Vordergrund.
Im Forschungsbereich AUTONOMES FAHREN werden die ersten Grundlagen zum Aufbau einer Prüfumgebung für autonome Fahrzeuge geschaffen. Langfristiges Ziel ist der Nachweis der Funktionalität des Gesamtfahrzeuges als Hardware in the Loop. Es erfolgt der Aufbau der erforderlichen Kompetenzen im Bereich Test und Prüfung von Komponenten und Systemen des autonomen Fahrens. Dieses stellt einen wichtigen ersten Schritt zur Etablierung und zum Aufbau von Kompetenzen im Autonomen Fahren selbst dar und ist zunächst eng fokussiert auf das Thema Test und Prüfung, welches methodisch und versuchstechnisch gemeinsam bearbeitet wird.
Im Teilprojekt "Prüfumgebung für automatisierte und autonome Elektrofahrzeuge" getragen von der Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik (Lehrstuhl Messtechnik und Lehrstuhl für elektromagnetische Verträglichkeit) werden grundlegende Betrachtungen zur Nutzung einer Radartargetsimulaton für automotive Anwendungen durchgeführt. Leitung Kompetenzzentrum eMobility Forschungsbereich Autonomes Fahren: Prof. Dr.-Ing. Ralf Vick.
Kompetenzzentrum eMobility - Forschungsbereich Gesamtfahrzeug: Teilprojekt "Energieeffizientes und EMV-gerechtes Hochvoltnetz für Elektrofahrzeuge"
Laufzeit: 01.01.2019 bis 31.12.2021
- unterschiedliche Zellentypen einsetzbar
- Optimierungspotential für den elektrischen Antriebsstrang
- bereits im Entwurfsstadium auf Komponenten und Systemebene
- mittels Simulationen und Messungen am Versuchsaufbau
Für den Demonstrations- und Transfercharakter des Gesamtvorhabens werden in Zusammenarbeit mit der sachsen-anhaltinischen Industrie Anwendungsszenarien in Technologieträger operationalisiert und konsequent weiterentwickelt und optimiert.
Methode der modalen Parameter für die dünndrahtigen Leerlaufverdrahtungsstrukturen und die Methode der Singularitätserweiterung
Laufzeit: 01.08.2020 bis 31.12.2021
Verschiedene numerische Methoden (MoM, FDTD usw.) können zur Berechnung von Strömen und Spannungen verwendet werden, die durch externe EM-Felder in Leitungssystemen induziert werden, sind aber nicht sehr hilfreich, um einen Einblick in die Physik von Kopplungsphänomenen zu gewinnen, insbesondere im Zeitbereich. Im Gegensatz dazu stellt die analytische Singularitätsexpansionsmethode (SEM) die streuenden Objekte als eine Menge von Oszillatoren dar und bietet damit ein physikalisch transparentes Werkzeug für die Beschreibung der Kopplungsphänomene, sowohl im Frequenz- als auch im Zeitbereich. Der Satz von SEM-Polen liefert den Hauptbeitrag für die Antwortfunktion (Funktional) der Übertragungsleitung auf die Anregung. Sie definiert auch die Streuungsamplitude, die Reaktion im Zeitbereich usw. Die Untersuchungen der SEM-Pole wurden früher durch die Analyse der Ergebnisse numerischer Berechnungen mit Hilfe der Momentenmethode (NEC) oder mit Hilfe analytischer Näherungsmethoden für lange horizontale Leitungen über der Erde durchgeführt. Kürzlich haben wir vorgeschlagen, die zuvor entwickelte Methode der modalen Parameter (MoMP) für die Analyse der Pole in kurzgeschlossenen Drahtstrukturen beliebiger geometrischer Form zu verwenden.
In dieser Arbeit wenden wir die Methode der modalen Parameter für die Untersuchung von SEM-Polen von Drähten im offenen Kreislauf an. Der Hauptakzent liegt dabei auf der Untersuchung von Teilen symmetrischer Drahtstrukturen: ein gerader endlicher Draht im freien Raum, ein gerader endlicher Draht parallel zu einer PEC-Masse, ein Kreisbogen und ein Helixsegment. Die Symmetrie dieser Strukturen erlaubt eine schnelle Berechnung von Matrixelementen im MoMP, insbesondere für den geraden Draht, wo man explizite analytische Ergebnisse erhält und Pole hoher Schichten untersuchen kann. Die Untersuchung hat gezeigt, dass der Realteil der SEM-Pole für einen endlichen geraden Draht im freien Raum, einen endlichen geraden Draht über einer Grundplatte und einen Kreisbogen-Draht mit zunehmender Polzahl monoton zunimmt. Im Gegensatz dazu wird für ein großes Segment des Spiraldrahtes eine komplexere Abhängigkeit des Realteils des SEM-Pols von seiner Anzahl n beobachtet. Dies ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass es für einige Zahlen n des Pols effektive gemeinsame Moden des Stroms gibt, was einer starken Strahlung und einem großen realen Teil der SEM-Pole entspricht, und für einige $n$ gibt es effektive differentielle Moden, was einer schwachen Strahlung und einem kleinen realen Teil der SEM-Pole entspricht.
Dieser Text wurde mit DeepL übersetzt
Netzwerkmodelle für geschirmte Kabel
Laufzeit: 01.01.2020 bis 31.12.2021
Geschirmte Leitungen werden in vielen elektrischen Systemen verwendet, um den Innenleiter vor leitungs"= und feldgebundenen Störungen zu schützen. Geflochtene Schirme bieten dabei eine höhere Flexibilität bei der Kabelführung als durchgehende Metallzylinder und werden daher häufiger verwendet. Durch die sich durch die Verflechtung ergebenden Öffnungen in der Abschirmung können Felder bis zu dem Innenleiter vordringen und das System stören. Diese Kopplungsmechanismen können in Netzwerksimulationsprogrammen nur in sehr begrenztem Umfang untersucht werden, da ihre Bibliotheken noch keine Modelle abgeschirmter Kabel über einer Masseebene aufweisen. Dies schränkt die EMV-Analyse geschirmter Systeme maßgeblich ein.
Im Rahmen dieser Arbeit wurden Netzwerkmodelle für geschirmte Leitungen basierend auf Leitungstheorie entworfen, die die Kopplung zwischen dem Außen- und Innenbereich des Schirmes und umgekehrt berücksichtigen. Damit sind sie für eine netzwerkbasierte Systemanalyse geeignet. Die entworfenen Netzwerke können die induzierten Spannungen aufgrund einfallender ebener Wellen berechnen und eine leitungsgebundene EMV-Analyse im Frequenz- und Zeitbereich durchführen. Die Modelle können sowohl Einzelkoaxialkabel als auch geschirmte Mehrfachleiter repräsentieren.
Ein Simulationsbeispiel für ein abgeschirmtes Kabel unter Berücksichtigung der Feldkopplung ist in dargestellt. Eine gepulste ebene Welle mit dem Einfallswinkel theta und dem elektrischen Feld E bestrahlt das Kabel. Die induzierte Störspannung des internen Systems ist dargestellt. Die Validierung erfolgt durch Vergleich der Ergebnisse mit der Simulationssoftware CST.
Numerische Simulation der Einkopplung transienter elektromagnetischer Felder in nichtlinear-abgeschlossene Leitungsnetzwerke mit einem SPICE-Netzwerksimulator
Laufzeit: 01.01.2020 bis 31.12.2021
Die Einkopplung externer elektromagnetischer Felder in Versorgungs-, Verbindungs- und Kommunikationskabel bestimmt maßgeblich die gestrahlte Störfestigkeit der daran angeschlossenen Systeme und Baugruppen. Kabelbäume können dabei als Leitungsnetzwerke modelliert werden, auf denen durch Feldeinkopplung angeregte Strom- und Spannungswellen entlang der Einzelleitungen propagieren und an Knotenpunkten sowie Abschlüssen transmittiert bzw. reflektiert werden.
Häufig sind Leitungsenden mit nichtlinearen Halbleiterbauelementen abgeschlossen, z.B. als Überspannungsschutz. Deren Berücksichtigung erfordert eine Simulation im Zeitbereich. Dabei können die als verlustarm angenommenen Leitungen als Kette von L-C-Gliedern modelliert werden. Das einfallende Feld einer ebenen Welle wird entsprechend der Agrawal-Formulierung als verteilte Spannungsquellen entlang der Leitung und als konzentrierte Spannungsquellen an den Leitungsenden wirksam.
Bei der transienten Simulation müssen diese Quellen an der n-ten Position der m-ten Leitung sowie weitere Quellen am o-ten Abschluss bzw. Knotenpunkt des Netzwerks mit der je nach Einfallsrichtung und Polarisation skalierten und zeitlich verschobenen Zeitfunktion des Feldes beaufschlagt werden. Dazu können die Quellen z.B. in einer Numeriksoftware wie MATLAB sehr einfach berechnet und direkt in einem ebenfalls in MATLAB programmierten Netzwerksimulator auf Basis der modifizierten Knotenspannungsanalyse zur Simulation des Leitungsersatzschaltbildes benutzt werden. Nachteilig ist dabei die komplexe Umsetzung nichtlinearer Lasten. Eine ideale Diode entsprechend der Shockley-Gleichung lässt sich noch vergleichsweise einfach berücksichtigen. Praktischere Dioden- und Transistormodelle, die mehr halbleiterphysikalische Eigenschaften beinhalten, sind jedoch deutlich komplexer in der Umsetzung.
Die in diesem Projekt entwickelte Idee ist, vorhandene SPICE-basierte Netzwerksimulatoren für die transiente Simulation der Feldeinkopplung in ein Leitungsnetzwerk zu nutzen. Die entsprechenden Netzlisten mit den zahlreichen unterschiedlichen Spannungsquellen werden anhand der Simulationsparameter automatisiert aus MATLAB heraus erstellt. Vorteilhaft ist dann die Nutzbarkeit der großen Fülle an vorhandenen und teilweise proprietären Halbleiterbauelementbibliotheken sowie die Möglichkeit der automatischen Zeitschrittwahl zur besseren Effizienz und Konvergenz der numerischen Lösung.
Im Projekt wurde erstmalig ein numerisches Simulationsverfahren für die transiente Feldeinkopplung pulsförmiger ebener Wellen in Leitungsnetzwerke mit nichtlinearen Abschlüssen entwickelt, das auf üblichen SPICE-kompatiblen Netzwerksimulatoren basiert. Gegenüber ähnlichen vorhandenen Verfahren sind viele weitere Halbleiterbauelementmodelle nutzbar. Weiterhin wird die Effizienz und numerische Stabilität des Simulationsverfahrens erhöht.
F&E RF-System für Neonatale MR-Tomographie
Laufzeit: 01.12.2018 bis 30.11.2021
Das vorliegende Projekt für die Komponente Gradientensystem ist ein Projekt, das die innovativen Komponenten eines neonatalen MRT-Systems abdecken. Es dient der Vorentwicklung eines Gradientensystems für diagnostische MR-Bildgebung bei 1.5T, inklusive Vorrichtungen zur aktiven Störunterdrückung, um die bilaterale elektromagnetische Verträglichkeit sicherstellen zu können.
Es geht in diesem Projekt ferner um den Aufbau von Know-How im Bereich Gradientensysteme. Dieses Know-How kann die Projektpartner nach Abschluss des Projekts in die Lage versetzen, die teure Komponente Gradientenspule in Magdeburg lokal zu fertigen, und das Risiko einer möglichen Abhängigkeit von den wenigen kommerziellen Anbietern zu verringern.
MEMoRIAL-M1.9 | Current visualisation during radiofrequency ablation (RFA) with MR coils
Laufzeit: 01.11.2017 bis 31.10.2021
Background
Real-time monitoring for radiofrequency ablation (RFA) is required to obtain information about the complete destruction of cancerous tissue. However, no RFA system exists that allows real-time MR monitoring. The MRI Hybrid Ablation system is an innovative system, where the MR scanner itself is used as a power source for RFA.
Objective
It was supposed to investigate whether it was possible to monitor a RFA procedure using the concept of an MRI hybrid ablation system.
Methods
By connecting an electrode to the coil port of the MR device, access to the RF infrastructure of the MRI can be required. Hereby, the electrode will be used for thermal destruction of tissue as well as for MR imaging. Electromagnetic and thermal field simulations were performed to numerically evaluate these possibilities. The simulations were validated while performing ablation experiments with protein phantoms and ex-vivo tissue in a MR environment. Here, the heat-based experiments were accompanied by acquisistions of temperature and flip angle maps.
Results
The thermally destroyed tissue correlates with the predictions from MR thermometry as well as the numerically calculated heat depositions. The flip angle maps als show a correlation with respect to the simulated MR signal distribution.
Conclusions
Using the concept of an MRI hybrid ablation system it is possible to perfom a thermal procedure and to monitor the RFA with MR thermometry. The approach of monitoring the ablation process by flip angle mapping is strongly compromised by long measurement times.
Originality
An approach has been developed to use the MR scanner as an "MR-compatible" therapeutic device. To date, no comparable, commercially available clinical RFA system exists that allows to monitor RFA with MR thermometry.
Keywords
MRI, radiofrequency ablation (RFA), thermometry, monitoring, hybrid system
Grundlagenuntersuchung zum Thema "Elektromagnetische Verträglichkeit, Funkstörungen im Frequenzbereich ab 1 GHz
Laufzeit: 01.04.2019 bis 30.09.2021
Im Rahmen der Studie wurden Möglichkeiten zur Grenzwertbildung von Störaussendung für Frequenzen oberhalb von 1GHz herausgearbeitet. Die relevanten Parameter zur Einbindung in die IEC Datenbank konnten aus den technischen Spezifikationen der Telekommunikationsstandardorganisation 3GPP abgeleitet werden. Die Einschränkungen des ursprünglichen CISPR TR 16-4-4 Verfahrens für die Anwendung oberhalb von 1GHz konnten aufgezeigt werden. Dennoch wurden Grenzwerte für die elektrische Feldstärke mit korrigierten Parametern aus dem CISPR-Verfahren abgeleitet. Da die relevanten Parameter zur Beschreibung von Mobilfunkdiensten vorrangig in Leistungswerten angegeben werden, wurde darüber hinaus ein auf Leistungswerten basierendes Verfahren eingeführt und erste Überprüfungen zur Anwendbarkeit in der Modenverwirbelungskammer durchgeführt.
Grundlagenuntersuchung zum Thema "Elektromagnetische Verträglichkeit, Funkstörungen im Frequenzbereich ab 1 GHz
Laufzeit: 01.04.2019 bis 30.09.2020
Im Rahmen der Studie wurden Möglichkeiten zur Grenzwertbildung von Störaussendung für Frequenzen oberhalb von 1GHz herausgearbeitet. Die relevanten Parameter zur Einbindung in die IEC Datenbank konnten aus den technischen Spezifikationen der Telekommunikationsstandardorganisation 3GPP abgeleitet werden. Die Einschränkungen des ursprünglichen CISPR TR 16-4-4 Verfahrens für die Anwendung oberhalb von 1GHz konnten aufgezeigt werden. Dennoch wurden Grenzwerte für die elektrische Feldstärke mit korrigierten Parametern aus dem CISPR-Verfahren abgeleitet. Da die relevanten Parameter zur Beschreibung von Mobilfunkdiensten vorrangig in Leistungswerten angegeben werden, wurde darüber hinaus ein auf Leistungswerten basierendes Verfahren eingeführt und erste Überprüfungen zur Anwendbarkeit in der Modenverwirbelungskammer durchgeführt.
Dedizierte interventionelle Spulen
Laufzeit: 01.02.2015 bis 31.12.2019
Empfangsspulen sind ein wichtiger Bestandteil eines jedes Magnetresonanztomographen, da diese die Bildqualität entscheidend beeinflussen. Für den diagnostischen Gebrauch gibt es bereits eine hohe Bandbreite an verfügbaren Konzepten, deren Eigenschaften speziell für diesen Zweck optimiert wurden. Jedoch lassen sich diese meistens nur schwer oder gar nicht auf die Bedingungen eines interventionellen Setups anwenden. Besondere Anforderungen für den Einsatz während eines bildgeführten chirurgischen Eingriffes sind die Sterilität und gute Handhabung der Spule d.H. der Interventionalist sollte möglichst wenig behindert werden. Problemstellungen hierbei sind z.B. die zu kleinen Spulenöffnungen und Kabelführungen in bestehenden Konzepten. Ziel in dem Forschungsprojekt ist es ein Konzept zu entwickeln das den Anforderungen auf einfache Weise gerecht wird, aber dennoch die Empfangseigenschaften der Spule so wenig wie möglich beeinträchtigt.
Erweiterung der SEM (Singularity Expansion Method) für dünne Drahtstrukturen
Laufzeit: 01.11.2017 bis 31.12.2019
Leitungen sind zur Informations- und Energieübertragung unverzichtbar. Jedoch koppeln über sie auch externe
elektromagnetische (EM) Felder in Geräte ein, die beispielsweise elektronische Schaltungen zerstören können. Daher ist die analytische Untersuchung der Leitungskopplung zum besseren Verständnis der physikalischen Phänomene und zur Erweiterung der mathematischen Methoden von großer Bedeutung. Die Singularity
Expansion Method (SEM) ist eine intuitive Methode zur Darstellung des induzierten Stromes auf beliebigen elektrisch leitfähigen Objekten. Motiviert durch experimentelle Ergebnisse wird der Strom im Zeitbereich durch eine Summe von gewichteten, gedämpften sinusförmigen Signalen dargestellt. Durch Laplace-Transformation
ergibt sich im Frequenzbereich eine Summe von gewichteten Polstellen. Die komplexen Polstellen werden allgemein auch natürliche Frequenzen genannt. Die natürlichen Frequenzen bestimmen die Position der Betragsmaxima der Frequenzantwort. Im Zeitbereich gibt ihr Imaginärteil die Frequenz des sinusförmigen
Signals und ihr Realteil die entsprechende Dämpfung an.Bemerkenswert ist, dass diese Frequenzen unabhängig von der Anregung (EM Feld, Stromquelle,…) sind. Daher ist eine Analyse der natürlichen Frequenzen zum tieferen Verständnis der Leitungskopplungsmechanismen von entscheidender Bedeutung. Das erste Ziel dieses Projektes ist die Weiterentwicklung von drei verschiedenen analytischen Verfahren zur Bestimmung der
natürlichen Frequenzen von dünnen Leitungsstrukturen im Frequenzbereich: - ein asymptotischer Ansatz, - die Methode der modalen Parameter, - die Leitungssupertheorie. Der asymptotische Ansatz ist ein physikalischer Ansatz, welcher durch weitere physikalische Betrachtungen erweitert werden soll, um den
Kopplungsmechanismus besser zu verstehen. Die Methode der modalen Parameter beleuchtet das Problem aus
funktionalanalytischer Sicht und hat den Vorteil, dass mit ihr die natürlichen Frequenzen in allen Schichten mit hoher Genauigkeit berechnet werden können. Als Drittes wird die Berechnung der
natürlichen Frequenzen aus Sicht der Leitungssupertheorie untersucht. Diese Theorie wurde am Institut des Antragstellers über Jahre entwickelt und soll nun unter dem Gesichtspunkt der SEM weiter analysiert werden. Das zweite Ziel ist die qualitative Untersuchung der Trajektorien der natürlichen Frequenzen in der komplexen Ebene bei Variation der Dimension und der Abschlüsse einfacher Leitungsstrukturen. Dadurch soll das Verständnis der Bedeutung der natürlichen Frequenzen erweitert werden. Außerdem sollen damit erste Versuche zur Identifikation verschiedener einfacher Leitungsstrukturen durchgeführt werden. Die analytischen Ergebnisse werden mit numerischen Simulationen und einfachen Messungen zur Validierung verglichen.
Ganzheitliche Optimierung energieeffizienter Antriebslösungen für Elektrofahrzeuge (GENIAL)
Laufzeit: 01.01.2016 bis 30.04.2019
Um den ganzheitlichen Ansatz zu verwirklichen, arbeitet das Projekt an Verbesserungen in drei Bereichen: Energiespeicher, Motor und Zusammenspiel aller elektrischen Komponenten. Mit der Speicherung der immer wieder kurzzeitig auftretenden Bremsenergie in einem Superkondensator, statt wie bisher üblich in der Lithium-Batterie, werden Leistungsverluste vermieden und die Zahl der Ladezyklen verringert. Zusätzlich werden Spannungswandler und E-Motor mit neuartigen Regelungsverfahren optimal aufeinander abgestimmt, um weitere Energieverluste zu minimieren. Durch neue Mess- und Simulationsverfahren werden die genannten elektronischen Komponenten integriert, um eine gegenseitige Beeinflussung und Störgrößen im laufenden Betrieb zu minimieren.
Mit den erwarteten Ergebnissen wird das Projekt die Effizienz von E-Fahrzeuge auf mehreren Ebenen steigern: Das verbesserte Motordesign trägt zur Erhöhung der Reichweite bei. Durch den neuartigen Einsatz von Superkondensatoren wird die Leistung und Lebensdauer der Batterie signifikant erhöht. Schließlich bewirkt die Reduktion von elektronischen Störungen einen reibungslosen Betrieb und führt zu Zeit- und Kosteneinsparungen bei zukünftigen Entwicklungen.
EMV Verhalten von elektrischen Motoren im KFZ- COMO II
Laufzeit: 01.01.2015 bis 31.12.2018
In modernen Fahrzeugen führen elektrische Anriebe aufgrund des schnellen Schaltens der leistungselektronischen Stellglieder zu elektromagnetischen Störungen. Diese können auf benachbarte elektronische Komponenten überkoppeln und Fehlfunktionen verursachen. Die Sicherstellung der zuverlässigen Funktion erfordert eine Systembetrachtung, die heute nur noch durch komplexe Simulationen möglich ist. In dem Projekt werden Ersatzmodelle für elektrische Maschinen entwickelt, die es erlauben, das Verhalten dieser im System zu simulieren.
Analyse der Einkopplung statistischer elektromagnetischer Felder in Leitungsstrukturen
Laufzeit: 01.05.2015 bis 30.04.2018
Das Forschungsprojekt dient der Untersuchung der Einkopplung von statistischen elektromagnetischen Feldern mit einem schmalbandigen Spektrum in elektrische und elektronische Baugruppen, Geräte und Systeme. Solche Felder treten im Rahmen der elektromagnetischen Verträglichkeit in elektromagnetischen Modenverwirbelungskammern (einer alternativen Messumgebung für gestrahlte Störfestigkeits- und Störemissionstests) und in elektrisch großen und geometrisch komplexen Hohlraumresonatoren (wie Schiffen, Flugzeugrümpfen, Fahrzeugkarosserien, Satellitengehäusen und industriellen Umgebungen mit großen metallischen Strukturen) auf. Während des Projektes werden bereits vorhandene Modelle für statistische Felder und bereits entwickelte analytische und analytisch-numerische Berechnungsmethoden für die Einkopplung solcher Felder in einfache Systeme (z. B. elektrische Verbindungsleitungen) zusammen mit neu zu entwickelnden Simulationsverfahren zur Analyse der Kopplung angewendet. Ausgewählte Simulationsergebnisse werden mit experimentellen Daten aus Messungen in Modenverwirbelungskammern verglichen. Die im Projekt zu gewinnenden Erkenntnisse können zur Etablierung von effizienteren und exakteren Messverfahren der elektromagnetischen Verträglichkeit beitragen.
Analysemodelle für die Verkopplung von Resonatoren und Leitungen mit stochastischer Geometrie
Laufzeit: 01.11.2015 bis 31.10.2017
Die Analyse von stochastischen Leitungsstrukturen innerhalb vonResonatoren beinhaltet zeitaufwendige numerische Berechnungen der stochastischen Eigenschaften von Spannungen und Strömen. Die Unterschiede in Analyseergebnissen zwischen verschiedenen Konfigurationen sind häufig schwierig zu interpretieren. Es kann oft nicht eindeutig geklärt werden, ob diese Abweichungen durch das verwendete Modell oder durch tiefere physikalische Zusammenhänge verursacht werden. Eine genauere Analyse kann nur mittels analytischer Modelle erfolgen. In abgeschlossenen Projekten wurde
bereits eine modellunabhängige Theorie von Leitungen mit stochastischer Geometrie entwickelt. Auch effektive analytische Methoden zur schnellen Analyse von deterministischen Leitungen in Resonatoren wurden entwickelt. In diesem Projekt ist es geplant, die Methoden mit dem Ziel weiterzuentwickeln, stochastische Leitungsstrukturen, die in Resonatoren angeordnet sind, zu analysieren. Insbesondere werden analytische Methoden zur Untersuchung der stochastischen Eigenschaften der Streumatrix der Leitung abgeleitet und die Antwort der Leitung auf externe Feldeinkopplung beschrieben.
Einfluss regenerativer Einspeisung und energieeffizienter Betriebsmittel auf Spannungsqualität und elektromagnetische Verträglichkeit
Laufzeit: 01.09.2015 bis 30.09.2017
Die Zahl der Betriebsmittel, die sich ungünstig auf die Spannungsqualität auswirken, steigt stetig. Ebenso wächst die Forderung nach mehr Energieeffizienz bei gleichbleibender oder gar verbesserter Versorgungszuverlässigkeit. Die derzeitige Entwicklung von zentralisierter Energieversorgung hin zu Smart Grids erfordert neue Ansätze. Die Vorhersage der zu erwartenden Effekte verlangt mathematische Modelle, die in der Lage sind, die Wechselwirkungen zwischen den Betriebsmitteln widerzuspiegeln. So können bei fortschreitender Änderung der Zusammensetzung des elektrischen Versorgungssystems mögliche Gefährdungen für die Spannungsqualität und die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) erkannt und durch Simulation Gegenmaßnahmen kosteneffizient auf ihre Wirksamkeit hin untersucht werden. Reproduzierbare Messungen bilden die Basis für die Entwicklung geeigneter Modelle. Das Vorhaben umfasst die Konzeption, Anschaffung, Installation und Inbetriebnahme eines Versuchsstandes bestehend aus einem hochleistungsfähigen Netzsimulator, einem PV-Simulator, verschiedenen elektronischen Lasten und adäquatem Messequipment. Das System wird vollständig in bereits bestehende Laborhallen integriert. Zusammen mit bereits vorhandener Laborausstattung wird damit eine umfassende Analyse nichtlinearer Betriebsmittel und Erzeuger auf die Spannungsqualität und die EMV im Rahmen künftiger wissenschaftlicher und industrieller Forschung ermöglicht.
Diagnose- und Monitoringsysteme für Kabelnetze der Zukunft - Fehlerortung im Frequenzbereich und EMV
Laufzeit: 01.10.2012 bis 31.01.2016
Die Prüfung/Diagnose und Monitoring von Energiekabeln kommt eine besondere Bedeutung zu. Die derzeit am Markt verfügbaren Instrumentarien und Systeme sind unzureichend, so dass enormer Entwicklungsbedarf besteht, um den sich abzeichnenden (Welt-) Markt bedienen zu können. Das Projekt hilft die Lücke zwischen wachsender Anforderung und Technologieangebot zu schließen und bereitet den weiteren Weg um als Spin-Off auch eine kosteneffiziente online Überwachung von Kabeln und Endverschlüssen zu ermöglichen. Das Forschungsprojekt hat zum Ziel Algorithmen für eine automatische Fehlerortung in verzweigten Energieversorgungsnetzen zu entwickeln und Methoden und Technologien für eine Sensorik und Auswerteeinheit für ein Online/Offline Messung von wichtigen Kabelqualitätskriterien zu erforschen.
Effiziente analytische Berechnung der Einkopplung von ebenen Wellen in gleichförmige Leitungen mit beliebigen Abschlusswiderständen im Zeitbereich
Laufzeit: 01.01.2015 bis 31.12.2015
Im Forschungsprojekt wurde ein effizientes Berechnungsschema für die transiente Einkopplung ebener Wellen in gleichförmige Leitungen entwickelt. Die Methode basiert auf geschlossenen Gleichungen, die in Form einer endlichen Summe ausgewertet werden. Die Methode ist sowohl für Einfachleitungen über einer leitfähigen Ebene als auch für Doppelleitungen im Freiraum anwendbar. Die Leitungen können dabei mit beliebigen Abschlusswiderständen abgeschlossen werden. Die einfallende ebene Welle kann durch jede Zeitfunktion beschrieben werden, deren Stammfunktion existiert. Im Vergleich mit einer Berechnung im Frequenzbereich und anschließender inverser Fouriertransformation ist die entwickelte Methode viel schneller, numerisch exakter und sehr einfach verständlich.
Eigenschaften von Volumenleiter im KfZ mittels analytischer und numerischer Verfahren
Laufzeit: 01.07.2013 bis 31.08.2015
Theoretische Betrachtungen von Leitungen beruhen in der Regel auf der Annahme von Dünndrahtanordnungen, wozu bereits viele bekannte und publizierte wissenschaftliche Erkenntnisse vorliegen. In der Praxis, z. B. in Elektrofahrzeugen, energietechnischen Anlagen und Überlandleitungen, werden allerdings zum Großteil Volumenleiter (dicke Leitungen) eingesetzt. Eine Übertragung der Beschreibung von Dünndrahtanordnungen auf Volumenleiter ist jedoch nicht möglich ist, und so gibt es nur wenige konkrete wissenschaftlich begründete Aussagen für Volumenleiter. Die Kenntnis der elektromagnetischen Eigenschaften und des Verhaltens von Volumenleiter hinsichtlich ihrer elektromagnetischen Verträglichkeit ist eine wichtige Voraussetzung zur optimalen wirtschaftlichen Nutzung von Leitungen in der Praxis.
Entwicklung neuer Geräte und Instrumente für die interventionelle Magnetresonanztomographie
Laufzeit: 01.03.2013 bis 31.01.2015
Die Entwicklung neuer Geräte und Instrumente für die interventionelle Magnetresonanztomographie stellt besondere Anforderungen an das Produktdesign. Insbesondere muss darauf geachtet werden, dass keine ferromagnetischen Stoffe verwendet werden, extrem hohe Störpegel im Umfeld des Tomographen auftreten können, der Tomograph selbst empfindlich gegenüber Störungen ist und alle Systems eine starke Wechselwirkungen mit dem menschlichen Körper ausbilden können. Besonders für den letzten Punkt ist es wichtig, die Erwärmung des menschlichen Körpers während des Eingriffes genau einschätzen zu können bzw. zu wissen welchen Einfluss diverse Instrumenteoder Materialien haben. Simulationen sind zur Zeit der einzige Weg verlässliche Angaben darüber machen zu können, weshalb sich um diese Aufgabe in den letzten Jahren verschiedenste Programmpakete etabliert haben. Jedoch handelt es sich dabei meist um kommerzielle Software.Am Lehrstuhl für Elektromagnetische Verträglichkeit wurde deshalb eine alternative Herangehensweise überprüft, indem ausschließlich frei verfügbare Programmpakete bzw. Modelle für die Berechnung verwendet wurden. Ziel war es zu zeigen, dass auch eine solch komplexe Fragestellung durch die geschickte Kombination diverser Tools bewerkstelligt werden kann. Eine solche OpenSource-Lösung bietet folgende Vorteile: freie Verfügbarkeit des Quellcodes, keine Lizenzgebühren und hohe Flexibilität, erfordert jedoch auch eine hohes Verständnis des Anwenders für die einzelnen Arbeitsschritte.
Anregung von Substrukturen in quaderförmigen Resonatoren durch elektrisch kleine Öffnungen
Laufzeit: 01.06.2013 bis 31.12.2014
Die Einflüsse von Öffnungen in leitfähigen Wänden von Hohlraumresonatoren auf die innere Feldverteilung sind entscheidend für die Kenntnis der Schirmdämpfung eines Gehäuses. Aktuelle Arbeiten beschreiben die durch die Apertur hervorgerufene Kopplung eines äußeren elektromagnetischen Feldes mit dem inneren Feld. So angeregte Hohlraum-Moden können gerade im hochenergetischen Resonanzfall, weitere Aperturen anregen und so einen Beitrag zum äußeren gestreuten Spektrum liefern. Diese Arbeit widmet sich anhand eines quaderförmigen Hohlraumresonators der mehrere Aperturen aufweist der Fragestellung, in wie weit eine Aussage über die Wechselwirkung zwischen den Hohlraummoden und des gestreuten Feldes des Resonators anhand von analytischen Modellen getroffen werden kann. Zu diesem Zweck wird in einem ersten Schritt ein analytischer Ausdruck für die Feldverteilung im Inneren des Resonators verwendet.
Messung der Einkopplung von statistischen Feldern in Doppelleitungen
Laufzeit: 01.01.2013 bis 31.12.2014
Am Lehrstuhl für Elektromagnetische Verträglichkeit wurde eine Theorie zur Einkopplung von statistischen Feldern in ein Leitungen entwickelt und bereits in mehreren Veröffentlichungen vorgestellt. Diese Theorie wurde schon durch Messungen an Einfachleitungen über einer leitfähigen Ebene validiert und sollte durch weitere Experimente mit einer geraden und gleichförmigen Doppelleitung bestätigt werden. Dazu wurde ein entsprechender Messaufbau in der großen Modenverwirbelungskammer an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg errichtet.
Vorhersage der leitungsgebundenen Emissionen von Hochspannungskabeln in Fahrzeugen
Laufzeit: 01.07.2013 bis 31.12.2014
Die schnell schaltenden Leistungselektronikgeräte, die in Schaltnetzteilen (SMPS) eingesetzt werden, erzeugen unerwünschte Ströme durch Streukapazitäten, die leitungsgebundene elektromagnetische Interferenzen (EMI) verursachen können. Daher ist die Vorhersage des leitungsgebundenen Emissionsrauschens (Common Moded (CM) und Differential Mode (DM)), insbesondere bei Resonanzfällen von SMPS, vor dem Prototyping wichtig. Das Ziel dieses Projekts ist es, ein geeignetes Modell des SMPS zu entwerfen, das verschiedene frequenzabhängige Effekte berücksichtigt. Darüber hinaus muss das Modell die Wege der CM- und DM-Ströme im Frequenzbereich beschreiben.
Dieser Text wurde mit DeepL übersetzt
Untersuchung der Eignung von verschiedenen Störemmisionsmessverfahren
Laufzeit: 01.08.2012 bis 30.09.2014
Zur Bestimmung der gestrahlten Störaussendung von Prüflingen existieren verschiedene Messverfahren, welche unterschiedliche Messgrößen erfassen. Diese Messgrößen können nicht in jedem Fall direkt ineinander umgerechnet werden und müssen auf die Referenzgröße, der elektrischen Feldstärke im Freirum, bezogen werden. Ziel des Projektes ist es, die Verfahren insbesondere hinsichtlich der Unsicherheiten bei der Bestimmung der Störemission elektrisch großer Prüflinge zu untersuchen und Möglichkeiten zur wechselseitigen Umrechnung der Ergebnisse anzugeben.
Hochfrequente stochastische Eigenschaften von Leitungen
Laufzeit: 01.09.2011 bis 31.12.2013
In dem Projekt wird die Kopplung elektromagnetischer Felder mit Leitungen beliebiger, stochastisch beschriebener Geometrie untersucht. Im Rahmen der Elektromangetischen Verträglichkeit lassen sich einige Beispiele solcher Problemstellungen anführen: · Bestimmung der durch externe elektromagnetische Felder in Mehrfachleitungen oder Kommunikationsgeräte induzierten Ströme und Spannungen sowie deren statistische Verteilungen. · Untersuchung der statistischen Eigenschaften der gegenseitigen Kopplung zwischen Leitungssegmenten zur Sicherstellung der internen EMV eines Systems. Im Projekt sollen bereits entwickelte analytische und analytisch-numerische Methoden zusammen mit neuen mathematischen Methoden der Physik (Diagrammtechnik und die Theorie der Gleichungen mit stochastischen Parametern) zur Analyse der Eigenschaften von Leitungen angewendet werden.
Modellierung nichtlinearer Lasten zur Untersuchung von Oberschwingungsphänomenen
Laufzeit: 01.10.2011 bis 31.12.2013
Zunehmende Ansprüche an die Steuerbarkeit und Umformung elektrischer Energie lassen den Einsatz von leistungselektronischen Betriebsmitteln in elektrischen Versorgungsnetzen wachsen. Diese Entwicklung erfordert gesteigerte Beachtung der Spannungsqualität im Netz, denn über leistungselektronische Schaltungen an das Netz angeschlossene Verbraucher sind die Ursache leitungsgebundener Störungen. Die harmonischen Ströme breiten sich im Netz aus, können interferieren und führen zu unerwünschten Spannungsabfällen an den Netzimpedanzen. Eine nachhaltige Sicherstellung der Versorgungsqualität erfordert die Simulation und Vorhersage des Verhaltens der harmonischen Ströme mit Hilfe mathematischer Modelle. Zur Nachbildung der Interaktionsphänomene zwischen den verschiedenen Oberschwingungsordnungen reichen konventionelle Methoden der Oberschwingungsanalyse wie das Modell der Konstantstromquelle oder das Norton Modell nicht mehr aus. Im Projekt Modellierung nichtlinearer Lasten zur Untersuchung von Oberschwingungsphänomenen werden daher Alternativen entwickelt. Der Fokus liegt auf dem Ansatz einer spannungsabhängigen Stromquelle. Die Modellierung erfolgt im Frequenzbereich. Die nichtlineare Last wird als Admittanz-Matrix modelliert, um die Abhängigkeit zwischen dem Vektor der Ströme und dem Vektor der Spannungen zu beschreiben.
Filterdesign mit Hilfe von Netzwerksimulationssoftware
Laufzeit: 01.03.2013 bis 31.10.2013
Der Einsatz von leistungselektronischen Schaltungen ist für den Betrieb von elektrischen Geräten notwendig. Diese Schaltungen verursachen elektromagnetische Störungen. Mit Hilfe von Filtern können die Störungen reduziert werden. Die resultierenden leitungsgebundenen Störungsarten lassen sich anhand von Filterschaltungen dämpfen. Um das Verhalten einer Filterschaltung ohne Messung darzustellen, kann mithilfe empirisch ermittelter Ersatzschaltbilder der einzelnen Bauteile die Impedanz der Schaltung simuliert werden. Für die Wahl der richtigen Bauelemente und Filter ist es in der EMV wichtig, die Ausbreitungsverhältnisse der geleiteten Störungen und das Frequenzverhalten der einzelnen Bestandsteile zu kennen. Es wurde ein Verfahren entwickelt, mit dem es möglich ist, die Ersatzparameter der einzelnen Bauteile und die daraus resultierende Impedanz einer Filterschaltung ohne aufwendige Messungen zu bestimmen.
Filter für Nebenaggregate
Laufzeit: 01.10.2012 bis 01.04.2013
Es wird der Aufbau von Filtern für Nebenaggregate am Hochvoltnetz untersucht und dabei der Einfluss des Laststromes auf die Filtereigenschaften (Sättigung, Surgebeanspruchungen) berücksichtigt. Es werden Filter in konventioneller Technik untersucht und analysiert, wie unter Low Cost Aspekten die typische 70/40 dB Dämpfungskurve erzielt werden kann. Die notwendigen Simulationsmodelle werden erstellt und die Eigenschaften des aufgebauten Filters mit unterschiedlichen Messverfahren verifiziert.
Messung der Einkopplung statistischer elektromagnetischer Felder in eine Leitung in einer Modenverwirbelungskammer
Laufzeit: 01.01.2012 bis 31.10.2012
Elektrische Leitungen sind häufig die Haupteinfallstore für elektromagnetische Felder in einen Prüfling. Eine Theorie zur Beschreibung der Einkopplung statistischer elektromagnetischer Felder, wie sie z. B. in Modenverwirbelungskammern oder in anderen elektrisch großen und geometrisch komplexen Hohlraumresonatoren wie Flugzeugrümpfen und Satellitengehäusen auftreten, wurde am Lehrstuhl für EMV entwickelt. Das Ziel dieses Forschungsprojekte war, die vorliegende Theorie durch Messungen zu validieren.
Einkoppelphänomene von stochastischen Feldern in Leitungsstrukturen
Laufzeit: 01.10.2008 bis 30.09.2012
Modenverwirbelungskammern werden zunehmend als alternative Testumgebungen für gestrahlte Störfestigkeitsuntersuchungen innerhalb der elektromagnetischen Verträglichkeit diskutiert. Entscheidend für die erfolgreiche weitere Anwendung ist ein tieferes Verständnis der Einkoppelmechanismen des statistisch homogenen und isotropen Feldes in komplexe Systeme. Da Leitungsstrukturen häufig einige wichtige Einkoppelstelle darstellen, sollen in einem ersten Schritt Einkoppelphänomene von stochastischen Feldern in einfache Leitungsstrukturen untersucht werden. In einem zweiten Schritt soll die Theorie auf ungleichförmige Mehrfachleitungen zur Betrachtung der Einkopplung in komplexe Systeme erweitert werden. Alle analytischen und numerischen Ergebnisse sollen mit experimentellen Daten validiert werden.
Etablierung der Modenverwirbelungskammer in der Normung als alternatives Prüfverfahren zur Messung der gestrahlten Störaussendung
Laufzeit: 01.05.2010 bis 31.07.2012
Zur Bestimmung der gestrahlten Störaussendung von Prüflingen existieren verschiedene Messverfahren, welche unterschiedliche Messgrößen erfassen. Diese Messgrößen sind nicht immer direkt ineinander umrechenbar. Ziel des Projektes ist es, die Verfahren insbesondere hinsichtlich der Unsicherheiten bei der Bestimmung der Störemission elektrisch großer Prüflinge und den Bezug zur Referenzgröße hin zu untersuchen und Möglichkeiten zur Umrechnung der Ergebnisse ineinander anzugeben.
Nutzung von numerischen Simulationstools bei der Konstruktion von HF-Erwärmungsmaschinen
Laufzeit: 01.02.2011 bis 30.12.2011
Es wird die Möglichkeit der Nutzung moderner elektromagnetischer Feldberechnungsverfahren zur Optimierung von HF-Erwärmungsprozessen untersucht. Dazu sind nutzbare Modelle zu erarbeiten und eine Abschätzung der Brauchbarkeit zur Berechnung dielektrischen Verluste und der Temperaturverteilung durchzuführen.
EMV und Messwertinterpretation im Umfeld der Hochspannung / Leistungselektronik
Laufzeit: 09.12.2009 bis 30.09.2011
Es werden die Grundlagen zur Entwicklung eines leistungsfähigen, modularen und effizienten Prüf- und Fehlerortungssystems für Seekabel und Energiekabel großer Länge, wie sie z.B. für den Einsatz bei Offshore-Windparks mit HGÜ benötigt werden, entwickelt. Dabei steht die Entwicklung von Modellen zur Simulation der elektromagnetischen Verkopplung im Prüfsystem und die theoretische Beschreibung der Ausbreitungsvorgänge von Mess- und Störsignalen unter Berücksichtigung der Mehrfachreflexionen in vermaschten Kabelnetzen im Focus des Projektes.
EMV im Umfeld kontaktloser Energieübertragung
Laufzeit: 01.10.2010 bis 31.08.2011
Bei der kontaktlosen Energieübertragung wird über einen Luftspalt induktiv Energie übertragen. Die Speisung des Spulensystems erfolgt in der Regel über einen Wechselrichter. Aufgrund der Schaltvorgänge können elektromagnetische Störaussendungen entstehen. Ziel ist es, diese Emissionen durch geeignete Modelle zu bestimmen
Entkopplungsmessungen an Hochvolt- und Bordnetzanschlüssen
Laufzeit: 15.09.2010 bis 31.03.2011
In Hybridfahrzeugen werden Komponenten eingesetzt, die sowohl am Hochvoltnetz als auch am Bordnetz betrieben werden. Damit besteht die Gefahr einer Verkopplung zwischen stark störenden und empfindlichen Komponenten. Ziel des Projektes ist die Analyse und messtechnische Bestimmung des Übersprechens der Systeme in unterschiedlichen Komponenten.
Stochastische Beschreibung der Abschaltimpulse beim Schalten induktiver Lasten im Kraftfahrzeug
Laufzeit: 01.03.2010 bis 30.09.2010
Im Projekt sind Simulationsmodelle zur Berechnung der auf Versorgungsleitungen resultierenden Impulse beim Ein- und Abschalten von induktiven Verbrauchern (Kleinmotoren, Motoren mit Fremderregung, elektromechanische Ventile) zu erstellen, deren Gültigkeit zu verifizieren. Dabei ist insbesondere die feststellbare Bandbreite realer Messergebnisse in der Simulation zu berücksichtigen, d.h. die Modelle sind parametrisierbar zu gestalten, so dass eine statistische Aussage über die auftretenden Spannungsamplituden möglich ist.
Analyse des Einflusses von Unsymmetrien auf das Abstrahlverhalten von symmetrischen Leitungen
Laufzeit: 01.10.2008 bis 31.05.2010
An Prüflinge angeschlossene Leitungen können bei hohen Frequenzen als Antenne wirken. Die Anregung hängt wesentlich von der Art des Leitungsanschlusses ab. Bei Frequenzen oberhalb von einem GHz ist zu klären, welchen Unterschied die symmetrische bzw. eine Speisung der Leitung hat. Es ist zu analysieren, wie sich bei symmetrisch betriebenen Leitungen eine Modenumwandlung eines symmetrischen Signals in ein asymmetrisches Signal entlang der Leitung auf die Störaussendung auswirkt.
Bewertung und Qualifizierung der Werkzeuge und Methoden zur Erreichung von Elektromagnetischer Verträglichkeit (EMV) für Elektrische Antriebssysteme
Laufzeit: 01.06.2008 bis 31.05.2010
Gemäß EMV-Gesetz muss heute jeder Hersteller eines elektrischen/elektronischen Geräts die Konformität seines Produktes mit den essentiellen Anforderungen des EMV-Gesetzes erklären. Durch die engere Nachbarschaft von Leistungselektronik und Signalelektronik bei geregelten Antriebssystemen steigt der EMV-Aufwand. Für jede Phase der Produktentwicklung sollten daher Analysen zur Erreichung der EMV in einer dem jeweiligen Wissensstand angepassten Tiefe durchgeführt werden. Im Rahmen des Forschungsprojektes sind die möglichen Analysewerkzeuge auf ihre Brauchbarkeit und ihre bevorzugten Einsatzbereiche zu untersuchen und die Grenzen und Möglichkeiten der Werkzeuge zu beschreiben. Alternative Verfahrensmethoden für die numerische Analyse des elektromagnetischen Verhaltens geregelter Elektroantriebe werden analysiert und beschrieben. Das erlangte Wissen wird den beteiligten Firmen verfügbar gemacht.
Einfluss stochastischer Parametervariationen von Übertragungsstrukturen in komplexen Systemen
Laufzeit: 01.04.2008 bis 31.12.2009
Verbindungsstrukturen in komplexen technischen Systemen unterliegen in Ihren Eigenschaften statistischen Schwankungen z.B. bedingt durch Produktionstoleranzen. Ziel des Projektes ist es, Verfahren zur Beurteilung des Einflusses dieser Schwankungen auf das Verhalten elektrischer Größen zu bestimmen. Dafür ist die Behandlung der Übertragungsstruktur als ungleichförmige Leitung notwendig. Hierfür müssen Methoden zur Bestimmung der ungleichförmigen Leitungsparameter sowie die Lösung der daraus resultierenden Matrix-Differentialgleichung entwickelt werden. Auf der Basis dieser deterministischen Verfahren sind Modelle für die eine stochastische Analyse zu entwickeln. Die entwickelten Modelle und Verfahren sind messtechnisch an Beispielanordnungen zu validieren.
Abschaltimpulse von Kleinmotoren in Kraftfahrzeugen
Laufzeit: 01.03.2009 bis 30.06.2009
Zahlreiche Komfortmerkmale in modernen Mittel- und Oberklassefahrzeugen basieren auf Gleichstrommotoren, die oftmals mit elektromechanischen Relais geschaltet werden. Aus Sicht der EMV sind transiente Spannungsimpulse problematisch, die beim Abschalten von Gleichstrommotoren entstehen, da diese in andere Komponenten einkoppeln können. Neben dem Gleichstrommotor beeinflussen auch das Schaltrelais und ein eventueller Entstörkondensator den resultierenden Impuls. Damit diese Störphänomene bereits während des Entwicklungsprozesses berücksichtigt werden können, sind Modelle notwendig, mit denen sich die resultierenden Impulse abschätzen lassen. Zu diesem Zweck wurde ein SPICE- Modell zur Simulation der zu erwartenden Spannungsimpulse erstellt, welches den Motor und das Schaltrelais als Teilmodelle berücksichtigt. Die Modellparameter wurden aus Herstellerangaben und empirisch ermittelten Daten des realen Motors generiert. Unterschiedliche Lastzustände des Motors können bei der Simulation berücksichtigt werden. Die Simulationsdaten wurden messtechnisch verifiziert.
Theoretische Untersuchung von Verfahren zur Bestimmung der Ausbreitungsgeschwindigkeit elektromagnetischer Wellen in Leitungen
Laufzeit: 01.05.2008 bis 30.09.2008
Die Notwendigkeit, Positionen von Kabelfehlern zu bestimmen (Ort der elektrischen Leitungsunterbrechung, des Isolationsdefekts, des Kabelschirmfehlers, der Geometrieänderung des Leitungsabschnitts), besteht für verschiedene Anwendungen von Telekommunikations-, Strom-, Daten- und Impulsleitungen. Im Forschungsprojekt wird die Schätzung der Leitungslänge basierend auf Zeit- und Frequenzbereichsmethoden dargestellt und die Simulationsergebnisse werden an Messergebnissen gespiegelt.